
- Startseite
- 13_Damenplatz
 Der Damenplatz auf dem historischen Lageplan | 1884
Der Damenplatz auf dem historischen Lageplan | 1884 Plan von 1884 mit erhaltenem Baumbestand
Plan von 1884 mit erhaltenem Baumbestand Rekonstruktion um 1900 anhand historischer Aufnahmen
Rekonstruktion um 1900 anhand historischer Aufnahmen Der Damenplatz | um 1905
Der Damenplatz | um 1905 Der Damenplatz | um 1914
Der Damenplatz | um 1914 Der Damenplatz | um 1915
Der Damenplatz | um 1915 Der Damenplatz | um 1916
Der Damenplatz | um 1916 Der Damenplatz | um 1935
Der Damenplatz | um 1935 Der Damenplatz | um 1940
Der Damenplatz | um 1940 Der Damenplatz | um 1945
Der Damenplatz | um 1945 Der Damenplatz | um 1945
Der Damenplatz | um 1945 Der Damenplatz | um 1954
Der Damenplatz | um 1954
Das Kloster Malchow
Der Damenplatz
TEXT ANZEIGEN
Rund um den Platz mit der großen 300 Jahre alten Linde im Zentrum lagen die Wohnungen der Konventualinnen oder auch Stiftsdamen. Irgendwann setzte sich dann die Bezeichnung Damenplatz für die Fläche zwischen diesen Wohnhäusern durch, die wir bis heute dafür nutzen.
Die Linde wurde ursprünglich als zentraler Hofbaum gepflanzt. Der Vermessungsplan aus dem Jahr 1884 zeigt den Damenplatz dann als Schmuckfläche mit verstreut platzierten Nadelbäumen. Die gleichmäßig barock anmutende Wegeführung läuft sternförmig auf das Zentrum zu und gliedert den Platz so in acht Segmente. In der Mitte treffen sich die Wege in einem Rondell um die Hoflinde. Nach Südosten wurde der Platz durch eine Lindenreihe räumlich abgeschlossen und optisch von der Bebauung an der Klosterstraße getrennt.
Die barocke Gestaltung entsprach irgendwann nicht mehr dem Zeitgeist und wurde um 1900 vereinfacht. Durch historische Fotos und Postkarten ist die Entwicklung des Damenplatzes ab dieser Zeit sehr gut dokumentiert. Es entstanden zusätzliche Wege und Blumenrabatten. Einige Zierbäume wurden gepflanzt und moderne Gaslaternen in den Platzecken installiert. Dennoch kann man sagen, dass die neue Gestaltung auf der vorangegangenen basiert. Statt acht Segmenten behält sie eine Vierteilung der zentralen Fläche bei. Hinzu kommt ein inneres Wegesystem, dass an drei Seiten parallel zu den Hauptwegen des Platzes und zur Abtrennung der Lindenreihe verläuft.
Alle Bereiche entlang der Wege erfuhren im Laufe der Jahrzehnte immer wieder unterschiedlich starke Veränderungen. Für die Gestaltung verwendete man unter anderem: geschnittene Ziersträucher, Blumenrohr, Sonnenblumen, Strauchhortensien, Chinesischen Flieder, Rhododendren, Pfingstrosen, Christrosen, blühende Bodendecker und Rosenrabatten. Später dann kamen dann blühende Magnolien, Rasenflächen, Efeu und kegelförmig geschnittene Nadelbäume auf den Platz. Dieses Gestaltungskonzept hatte bis in die 1940er Jahre Bestand. Aber schon damals waren deutliche Unterhaltungsmängel erkennbar. Insbesondere gab es keine Verjüngungsschnitte mehr und so war schon ab den 1950er Jahren die ursprüngliche Gestaltungsidee durch das Verschwinden von Zierformen und durch das Fällen von Bäumen nicht mehr zu erkennen.
Die historische Gartenanlage ging so größtenteils verloren. Geblieben sind nur die Bäume, die Reihe Chinesischen Flieders und eine um 1930 gepflanzte Magnolie.
Der Damenplatz
Rund um den Platz mit der großen 300 Jahre alten Linde im Zentrum lagen die Wohnungen der Konventualinnen, die auch als Stiftsdamen bezeichnet werden. Irgendwann setzte sich für die Fläche zwischen diesen Wohnhäusern die Bezeichnung Damenplatz durch, die wir bis heute dafür nutzen.
Die Linde wurde ursprünglich als zentraler Hofbaum gepflanzt. Der Vermessungsplan aus dem Jahr 1884 zeigt den Damenplatz dann als Schmuckfläche mit verstreut platzierten Nadelbäumen. Die gleichmäßig barock anmutende Wegeführung läuft sternförmig auf das Zentrum zu und gliedert den Platz so in acht Segmente. In der Mitte treffen sich die Wege in einem Rondell um die Hoflinde. Nach Südosten wurde der Platz durch eine Lindenreihe räumlich abgeschlossen und optisch von der Bebauung an der Klosterstraße getrennt.
GANZEN TEXT ANZEIGEN
Die barocke Gestaltung entsprach irgendwann nicht mehr dem Zeitgeist und wurde um 1900 vereinfacht. Durch historische Fotos und Postkarten ist die Entwicklung des Damenplatzes ab dieser Zeit sehr gut dokumentiert. Es entstanden zusätzliche Wege und Blumenrabatten. Einige Zierbäume wurden gepflanzt und moderne Gaslaternen in den Platzecken installiert. Dennoch kann man sagen, dass die neue Gestaltung auf der vorangegangenen basiert. Statt acht Segmenten behält sie eine Vierteilung der zentralen Fläche bei. Hinzu kommt ein inneres Wegesystem, dass an drei Seiten parallel zu den Hauptwegen des Platzes und zur Abtrennung der Lindenreihe verläuft.
Alle Bereiche entlang der Wege erfuhren im Laufe der Jahrzehnte immer wieder unterschiedlich starke Veränderungen. Für die Gestaltung verwendete man unter anderem: geschnittene Ziersträucher, Blumenrohr, Sonnenblumen, Strauchhortensien, Chinesischen Flieder, Rhododendren, Pfingstrosen, Christrosen, blühende Bodendecker und Rosenrabatten. Später kamen dann blühende Magnolien, Rasenflächen, Efeu und kegelförmig geschnittene Nadelbäume auf den Platz. Dieses Gestaltungskonzept hatte bis in die 1940er Jahre Bestand. Aber schon damals waren deutliche Unterhaltungsmängel erkennbar. Insbesondere gab es keine Verjüngungsschnitte mehr und so war schon ab den 1950er Jahren die ursprüngliche Gestaltungsidee durch das Verschwinden von Zierformen und durch das Fällen von Bäumen nicht mehr zu erkennen.
Die historische Gartenanlage ging so größtenteils verloren. Geblieben sind nur die Bäume, die Reihe Chinesischen Flieders und eine um 1930 gepflanzte Magnolie.


Erddamm

Wäsche

Krankenhaus

Schmiede

Bollwerk und Promenade

Klosterkirche

Pastorat

Kreuzganghof

Refektorium

Dormitorium

Haus der Domina

Mauergarten

Damenplatz

Reihenhäuser der Konventualinnen | 1

Haus des Küchenmeisters

Reihenhäuser der Konventualinnen | 2

Amtshaus

Gefängnis

und Wirtschaftshof

Engelscher Garten

Klosterfriedhof

Friedhofskapelle

Gräberfeld der Konventualinnen

Remise und Stellmacherei
ALLE OBJEKTE ANZEIGEN
Krankenhaus
Klosterschmiede
Bollwerk und Promenade
Klosterkirche
Pastorat
Kreuzganghof
Refektorium
Dormitorium
Haus der Domina
Mauergarten
Damenplatz
Reihenhäuser 1
Haus des Küchenmeisters
Reihenhäuser 2
Amtshaus
Gefängnis
Engelscher Garten
Klosterfriedhof
Friedhofskapelle
Gräberfeld der Konventualinnen
Stellmacherei
Genauer Standort in Google Maps
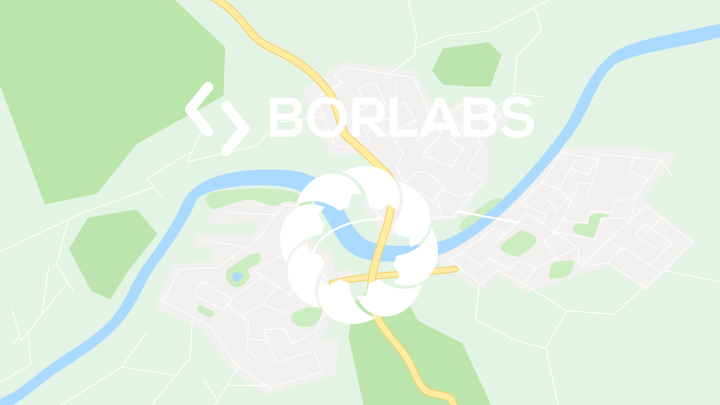
Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren
